
08 März Neun Jahre danach – 9. März 2015
Heute veröffentliche ich aus gegebenem Anlass einen Text, den ich vor neun Jahren, kurz nachdem Tod meines ältesten Sohnes geschrieben habe.
Die Redaktion der ZEIT-Beilage Christ & Welt, heute Credo, plante damals eine Ausgabe mit dem Schwerpunkt zum Thema Suizidtrauernde. Im Vordergrund sollten nahe Angehörige stehen, die einen Menschen durch Selbstmord verloren hatten. Da das Thema in den Medien oftmals tabuisiert wird und wenig Beachtung findet, wollten sie für Hinterbliebene und ihre Trauerbewältigung sensibilisieren. Ich wurde damals gefragt, ob ich etwas zum Thema schreiben möchte. Habe ich getan.
Da jeder einzelne Satz auch heute für mich volle Gültigkeit besitzt, ebenso die Motivation der Zeit-Redaktion, veröffentliche ich diesen Text. Das Beitragsbild zeigt den Aufkleber, den die Freunde meines Sohnes damals anstelle einer Traueranzeige in die Welt brachten, in Erinnerung an den prachtvollen Schnorres, den er damals zu tragen pflegte.
Nach Woche 9: Trost kann es nicht geben – jetzt noch nicht
Sein Tod reißt mich um – zerfetzt. Von einem Moment auf den anderen ist nichts mehr, wie es war – und dass es das auch nie mehr werden wird, sickert erst viel später nach – zum Glück. Manchmal geht eine dieser Seelen-Klappen, hinter denen das nachtschwarze Grauen lauert, nur einen Spalt weit auf, haut mich um und der Schmerz ist unerträglich. Ich ahne, dass es mich auslöschen würde, wenn sich all die Klappen auf einmal komplett öffneten.
In diesen schrecklich-blutig-traurigen ersten Wochen haben wir viel Kondolenz-Post erhalten, was an sich wundervoll ist, da sich so viele Menschen nahe fühlen und versuchen, dem Ausdruck zu verleihen. Auch zu sehen, wen er alles kannte, wer ihn mochte. All die wundervollen Geschichten über ihn erzählt zu bekommen, die ich sonst nie erfahren hätte – was für ein Geschenk! Also gilt erst mal natürlich Dank all denen, die mitfühlen und mitteilen wollen. (Ehrlich, ich wüsste auch heute noch nicht, was ich einem Menschen in meiner Situation schreiben sollte – außer: Scheiße! Was für eine Scheiße!)
Doch, es kommt ein Aber:
Was ich wirklich schwer ertrage ist diese geknickte, klebrige Betroffenheit, wenn sie sagen, sie denken die ganze Zeit an mich, an uns, an ihn. Das kann nicht stimmen und hilft auch nicht; ist sicher Ausdruck von Verunsicherung – ihrer, wie meiner -, aber ich will gerade kein Verständnis für Andere aufbringen: Trotz gehört mit gleicher Wucht zu diesem emotionalen Supergau, den es jetzt zu überleben gilt – nur überleben, einen Tag nach dem anderen. Wenn sich die Unsicherheit und Überforderung des Anteilnehmen-Wollenden dann noch paart mit selbsterkannten Zukunfts- und Jenseits-Visionen aus dem jeweiligen Glaubensbereich, dann könnte ich ehrlich kotzen! Vor allem, wenn dem mehr, oder weniger unterschwellig anhaftet, dass das nicht rechtens von ihm war, oder ob er doch krank war?
Nein, nicht dass er krank war – dass er tot ist, das ist die Tatsache! Spekulationen sind jetzt etwas für Masochisten, oder Sensationsgierige.
Allein die Begrifflichkeit ist eine Herausforderung: Selbstmord – brutal. Juristisch vielleicht passender, aber grässlich technisch klingt Selbsttötung. Suizid, mir zu medizinisch unpersönlich. Mein Sohn hat sich das Leben genommen – so kann ich es für formulieren; er hat sich im Leben immer viel (heraus)genommen – nun das Maximale, Unabänderliche.
Trotz aller grauenvoll schmerzlichen Trauer, in der er uns zurücklässt, gibt es für mich eine sonderbar tröstliche Stimmigkeit darin, selbst im Weg, den er gewählt hat. Und es gibt niemanden, der mich da belehren könnte, oder es versuchen sollte. Kein Besserwisser-Psychologe, der behauptet, jedem Suizid gehen nicht geführte Gespräche voraus. Was für eine Vermessenheit, die bei mir sofort erst Betroffenheit und Versagensdruck hervorruft, mit dem zweiten Atemzug dann aber unbändige WUT! Wir haben geredet, bis zum Schluss. Wundervolle Gespräche waren das mit einem klugen, großherzigen und mutigen Menschen, die ich jetzt schon vermisse.
Kein kirchlich Geistlicher – ich bin froh, und ehrlich dankbar, mich nicht mit dem katholischen Blick auf das Thema auseinandersetzen zu müssen. Ich glaube nicht, ich trauere, denn ich werde ihn nicht wieder sehen, nicht hier, nicht ich, nicht ihn! Das gilt es zu verarbeiten – irgendwie, irgendwann.
Warum ist es für uns Hinterbliebene so schwer, akzeptieren zu können, dass ein Leben unerwartet zu Ende sein kann – seines zu Ende ist und er es war, der es beendet hat? Wenn ich Jungs in seinem Alter sehe, versuche ich, in jeder noch so fernen Ähnlichkeit, ihn zu entdecken und bin tief bekümmert, ihn nicht mehr älter werden zu sehen. Wenn ich Familien mit kleinen Kindern sehe, denke ich: Hoffentlich habt ihr euch und einander länger.
Jede Trauer ist in erster Linie Ausdruck der höchsteigenen Verlust-Angst-Versagens-Thematik. Ich bin damit also sowieso komplett auf mich zurückgeworfen.Trauer ist meine Arbeit! Anstrengende Arbeit! Heulen in dem Ausmaß ist Hochleistungssport. Verdrängen bringt gar nichts, dann kommt es nur versetzt verzehnfacht zurück! Betäuben, egal mit welcher Droge, oder wohl gemeinten Worten und Ablenkungen aller Art – alles Quatsch! Ich kann Saint-Exupéry und seinen kleinen Prinzen wirklich nicht mehr sehen: „Man sieht nur mit dem Herzen gut“ … mein Herz sieht nicht, es ist zerfetzt!
Jede und jeder, so auch ich, muss da alleine durch, gerne von umsichtigen Menschen, die ich mir aussuchen möchte, begleitet, die für eine Zeit neben mir in der Achterbahn sitzen wollen. Sie müssen nichtmal Händchen halten, es nur aushalten und möglichst normal mit mir reden und umgehen; oder von professioneller Seite geleitet. Alles, was die eigene Gefühlspalette in dieser Zeit so her gibt, dem muss ich mich stellen, und das ist verdammt viel. Aber nur dann kann wieder Friede im eigenen Seelenhäuschen, hinter all den hinterhältigen Klappen einziehen. Das glaube ich! Und das ist anstrengend, sehr anstrengend, macht auch trotzig – ein sehr kraftvoller Gefühls-Anteil.
Ich muss außerdem feststellen, dass ich in dem Moment, da ich mein großes Kind verloren habe, auf eine besondere Art erwachsen geworden bin und gerade selbst kein Kind einer Mutter mehr sein möchte.
Wie kommen andere darauf, zu behaupten: „Es gibt nichts Schlimmeres für eine Mutter, als das eigene Kind zu verlieren“ ? Gibt es eine Qualitätsskala von Leid, von Trauer und Schmerz? Warum sollte es für mich schlimmer sein, als wenn ein Kind seine Mutter verliert, die Quelle seines Urvertrauens und der Lebensfreude? Oder eine junge Familie den womöglich alleinverdienenden Vater – da stürzen ganz andere existenzielle Sorgen dazu.
Ein Unterschied ist: Diese Hinterbliebenen haben anerkannte neue Titel mit dem Verlust erhalten: Eine Kind wird Waise, eine Frau wird Witwe, oder er wird Wittwer. Ich habe ja noch nichtmal einen Titel, aber mir wird maximaler Kummer und Schmerz nicht nur zugetraut, sondern abverlangt!
Wo sind die Zusammenhänge von Qualität und Quantität in der Trauer? Jede und jeder trauert individuell maximal, und sicher jeder anders, was mit dem Platz im eigenen Leben zusammenhängt. Wenn ich vorher mich und mein Leben über einen anderen Menschen definiere, dann bricht alles weg, kaum ist er weg. Bin ich aber ich, bleibe ich – ich und bekomme die pure Körperlichkeit der Formulierung „Mein eigen Fleisch und Blut“ am eigenen Leib zu spüren. Wenn ich mir seinen letzten Lebens-Moment vorstelle (und oft muss ich mich streng wehren, dies nicht zu tun), dann schmerzt dabei jede einzelne meiner Zellen und Fasern.
Ich habe bei der Beisetzung die Urne mit der Asche meines Sohnes selbst in die Erde gelegt. Dieses Gefühl, den Sog heute noch in meinem Körper erinnernd nachvollziehen zu können, ist genauso wichtig und elementar für mein Verarbeiten, wie das mehrfache Besuchen seines aufgebahrten Leichnams; und ich musste mich so überwinden, allein das Wort „Leichnam“ zu sagen, vom ersten Besuch ganz zu schweigen. Seine Hand zu halten, über sein Gesicht zu streichen, den kühlen Brustkorb zu fühlen, in dem das Herz nicht mehr schlägt, alles noch so vertraut in meinen Händen und doch unwiderruflich zu Ende. All das war auf eine schmerzvolle Weise schön und wichtig, um Abschied zu nehmen, oder es zu versuchen.
Ich habe ihm Briefe vorgelesen und Märchen, Gute Nacht-Lieder gesungen, mich gefreut über all die Dinge, die ihm seine Freunde in den Sarg mitgegeben haben, geheult und ihn am Ende zugedeckt und darum gebeten, dass ich, seine Mutter, die letze sein will, die ihn, oder seine sterbliche, gestorbene Hülle in dieser Welt gesehen hat. Furchtbar, dieses letzte Mal die Türe zu schließen und zu wissen, es ist das letzte Mal. Jetzt gibt es neben meinen Träumen und Erinnerungen nur noch den Friedhof, auf dem ich ihn besuchen kann.
So viele neue Themen, mit denen ich mich bisher noch nicht auseinandergesetzt hatte: Unser jetzt gewählter Grabplatz ist an einem schönen Ort. Das bedeutet uns viel, hat es doch vielmehr mit Niederlassen und Heimat zu tun, als ich vorher dachte: Unsere Familie hat nun eine Grabstätte, was uns alle irgendwie beruhigt, und noch dazu eine schöne!
Auf seiner Grabplatte steht sein Name in seiner Handschrift. Seine Unterschrift abfotografiert, gescannt, tiefgestrahlt. Ich will es so. Er hat sein Leben beendet und dies hiermit signiert. Vielleicht brauchen wir ja doch das Pathos, empfundene Würde als Katalysator für die Verarbeitung – eine mehr, andere weniger, aber bitte kein Adagio aus den Lautsprechern im Bestattungs-Institut!
Kurz vor der Beisetzung schrieb mir eine Herzensschwester: „Wenn du das überstanden hast, gibt es nicht mehr viel, wovor du Angst haben musst.“
Sie hat Recht. Ich fürchte mich vor nichts mehr. Vieles ist unwichtig und klein geworden, „Mensch, werde wesentlich!“
Leider hat mein Urvertrauen, meine grundoptimistische fröhliche Sicht auf die Welt derzeit einen schweren Schlag weg bekommen: Es ist gerade in meiner Welt nichts mehr sicher, wenn eines meiner Kinder sicher nicht mehr in dieser Welt ist.
Durch diesen Schicksals-Schlag habe ich meine Intuition wieder genauer entdeckt – weiß, dass ich ihr/mir trauen kann: Ich will leben, lieben, leiden, lachen, weinen, gerade dann, wenn es mir danach ist. Das allein hilft – egal, ob im Supermarkt an der Kasse, im Konzert, beim Telefonat, oder Spaziergang.
Das ist sie, die Achterbahn. Wir haben schon am Tag nach seinem Tod gelacht. Wundervoll skurriler, auch schwarzer Humor. Genau das will die Seele, sie muss dem Schrecken etwas entgegen setzen, um zu überleben, und das ist gut! Wehe dem, der da mangelnde Pietät, oder Herzlosigkeit zum Vorwurf machen will!
Wieder und wieder grabe ich gedanklich in den letzten Sekunden seines Lebens, Minuten, Tagen, Monaten und Jahren, um Antwort zu suchen, die Lösung zu finden, dabei hat er sie längst vorgegeben: Er ist nicht mehr – und ich soll und darf und muss und will nun das Beste daraus machen, für uns, die wir hier sind, die mir wichtig sind, für mich und für ihn. Es ist unser Leben. Ich weiß, dass Selbstvorwürfe nichts bringen, außer noch größeres und unsinniges Leid. Ich habe ihn nicht retten können – Punkt.
Der Mensch will verstehen, wenn es aber nichts Begreifbares gibt, nimmt er sich selbst, das greift immer: Selbstdemontage ist spürbar, führt aber ausschließlich ins Bodenlose, also: Schnell, nichts wie raus da!
Ich bin nicht wütend auf ihn, nie. Ich glaube, dieses Gefühl schon zu seinen Lebzeiten aufgebraucht zu haben. Was bleibt ist meine Liebe und Bewunderung für dieses einzigartige Geschöpf und Geschenk, wirkliche Dankbarkeit, ihn gehabt, erlebt zu haben; aber auch die unendliche, wogende, tobende, schreiende, schmerzende Trauer. Manchmal versuche ich, das Gefühl nicht als gut, oder schlecht zu bewerten, sondern nur das Ausmaß der Intensität wahrzunehmen: Wenn wir verliebt sind, haut es uns um – vor Glück. Als sie mir sagten, er ist tot, schlug es mich um – vor Grauen.
Trost – den kann es vielleicht später geben. Wenn die Ruhe zurückkehrt, der Frieden. Es hilft gar nichts, von dieser alle Wunden heilenden Zauberin namens „Zeit“ zu reden, wenn sie für mich noch nicht gekommen ist. Aber irgendwann wird dem so sein. Man sagte uns, nach zehn bis zwölf Wochen ist die erste Phase geschafft. Ein erstes schweres Jahr gilt es durchzustehen, dann wird es lichter. Ich werde es sehen.
Ich kann jetzt schon auf ein kleines Stück zurück schauen und aus tiefstem Herzen sagen, dass ich so vieles, was in den letzten Wochen passiert ist, nicht noch einmal erleben möchte, vielleicht auch nicht noch einmal überleben kann und denke doch immer wieder an den Schlusschor aus der wundervollen Oper „Hoffmanns Erzählungen“ von Jaques Offenbach: „On est grand par l’amour, mais plus grand par les pleurs“.
So weine ich und wachse in ein Leben, das von nun an geprägt ist, dunkelviolett getönt, und trotzdem kann ich sagen: Ich liebe das Leben, mein Leben, unser Leben – auch wenn Vieles jetzt anders ist und Einer entsetzlich fehlt.
Franziska Dannheim, 2015
NOTA BENE: Die Zeit ist eine gnadenreiche Schwester. Gemeinsam mit ihr habe ich den dunklen See in seiner Tiefe durchmessen, streckenweise war es eine Achter-Geister-Bahn. Ich habe dabei auch viele schöne Dinge entdeckt und gefunden, die mir „oben an Land“ nicht begegnet werden. Heute weiß ich vor allem, dass mein Herz und meine Seele viel mehr aushalten, als vorher je gedacht. Sie weiten sich und schaffen Raum für Neues. Nennen wir es Zuversicht. So habe ich mich, wie Gottfried Preußens kleiner Wassermann vom Neunauge, eben nicht habe schrecken lassen am anderen Ufer wieder aufgetaucht. Bin wieder im wärmenden Sonnenlicht und bewundere die Pracht, am Ufer, am Grund, im Himmel, in mir. Ganz frei nach dem Sinnspruch: no mud, no lotus
„On est grand par l’amour, mais plus grand par les pleurs.“ Danke Herr Hoffmann, Herr Offenbach, Herr Carré und Herr Barbier, so ist es.
Franziska Dannheim, 2024

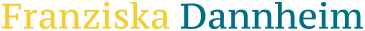
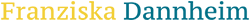

Pingback:Letzte UnRuh – und Du? Schon übers Ende nachgedacht? | Franziska Dannheim
Posted at 09:41h, 03 August[…] zuvor noch nie Gedanken gemacht hatte. Darüber schrieb ich ausführlicher in meinem Blogartikel Neun Jahre danach. Wir haben uns für ein Baum-Wiesen-Grab entschieden, also ging sein Leib durchs Feuer. Zur […]